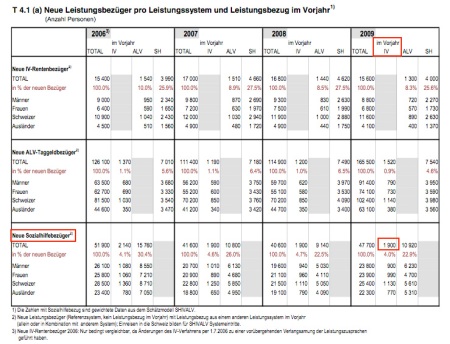Letzte Woche hat der Bundesrat die Botschaft zur «Weiterentwicklung der Invalidenversicherung» verabschiedet. Ein Schwerpunkt der Reform fokussiert darauf, psychisch beeinträchtigte Jugendliche besser zu unterstützen, damit sie den Übergang ins Berufsleben schaffen, statt zu IV-Bezügern zu werden.
Die NZZ zeichnete dazu einmal mehr das Bild von psychisch kranken jungen Menschen, die eine IV-Rente angeblich für «erstrebenswert» halten, weil «die Rente über dem Lohn der Gleichaltrigen liege». Effektiv erhält ein «Frühinvalider» (mit IV-Rente und Ergänzungsleistungen) 1600.-/Monat für den Lebensbedarf (plus Krankenkasse und Miete) und hat damit – abgesehen von wenigen Jahren während der Ausbildungszeit – ein ganzes Leben lang deutlich weniger Geld zur Verfügung als seine gleichaltrigen arbeitenden Kollegen.
Bei der NZZ denkt aber scheinbar kein einziger Journalist daran, dass auch aus einem Jugendlichen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung später einmal ein NZZ-Journalist mit entsprechendem Einkommen werden könnte. Ausserdem versucht die NZZ mit der einseitigen Forderung nach mehr Druck auf die betroffenen Jugendlichen subtil davon abzulenken, dass eine nachhaltige Integration ohne den verbindlichen Einbezug der Arbeitgeber schlicht nicht möglich ist.
Gegen verbindliche Vorgaben zur Zusammenarbeit mit der Invalidenversicherung wehrt sich nämlich der Arbeitgeberverband in seiner Stellungnahme mit Händen und Füssen. Man habe doch – so der Arbeitgeberverband – «ganz ohne Zwängerei» (ähem…) dafür gesorgt, «dass seit 2012 rund 75’000 Personen ihre Arbeitsstelle behalten oder eine neue Stelle finden konnten». Die jährlich von der IV-Stellenkonferenz erhobenen Zahlen betreffen allerdings in der Mehrheit der Fälle «erhaltene Arbeitsplätze beim gleichen Arbeitgeber». Aus unerfindlichen Gründen wird dabei auch nie die Anzahl der Eingegliederten mit einer psychischen Erkrankung bekannt gegeben, wohingegen man die Zahl der psychisch Kranken in der Statistik der RentenbezügerInnen immer explizit hervorhebt.
Es ist natürlich schön, wenn Mitarbeitende mit Rückenproblemen integriert nicht aus der Firma rausgeworfen werden. Aber nur anhand spezifischer Statistiken zu den erfolgreichen Eingegliederten mit einer psychischen Problematik sowie zu den effektiven Ausbildungsplätzen für psychisch beeinträchtigte Jugendliche kann beurteilt werden, ob die Arbeitgeber ihre Verantwortung in diesem Bereich tatsächlich wahrnehmen.
Jugendliche mit Persönlichkeitsstörungen und Schizophrenie sind nämlich diejenigen Betroffenen, die laut der Studie «Profile von jungen IV-Neurentenbeziehenden mit psychischen Krankheiten» (BSV, 2016) häufig zu vorschnell berentet werden. (Also bringt nicht immer kognitiv beeinträchtige Jugendliche als «erfolgreiche Beispiele», liebe Medien – das Problem liegt anderswo.)
. . . . . . .
Im folgenden Gastbeitrag erzählt My, wie es war, als damals psychisch stark angeschlagene junge Frau einen Praktikumsplatz zu bekommen. Und was daraus geworden ist.
. . . . . . .
Vor kurzem kam bei der Arbeit von einer Gruppenleiterin eine unerwartete Frage: «My, kann ich dich etwas fragen? Welchen Eindruck hattest du von der Schnupperpraktikantin?»
Welch eine Frage. Ich hatte das junge Mädchen nur rasch beim Hereinkommen gesehen, und dann nach dem Essen, als ich die Kinder beim Zähne putzen unterstützen sollte, ein paar Worte mit ihr gewechselt. Überrumpelt gab ich das erste von mir, was mir durch den Kopf ging: «Na ja, schwer zu sagen… sie ist sehr freundlich und sympathisch, vielleicht noch etwas unbeholfen?… Aber sie ist ja auch noch sehr jung.» Die Gruppenleiterin grinste: «Ok, das reicht mir.»
Kaum hatte ich diese Situation verlassen, grübelte ich über die möglichen Konsequenzen meiner unbedachten Aussagen. Was hatte die Gruppenleiterin daraus abgeleitet? Warum hatte ich mich so negativ ausgedrückt? Bekam die junge Frau nun vielleicht eine Absage, weil ich sie als «unbeholfen» bezeichnet hatte?! Ich hatte das ja gar nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht geklungen hatte. Sie schien noch nicht oft in einem Kinderheim gewesen zu sein, das wollte ich damit sagen, aber kann man das einer vielleicht zwanzigjährigen Anwärterin auf einen Praktikumsplatz wirklich vorwerfen?
Seither sind Wochen vergangen, und seither gärt es in meinem Hinterkopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau eine Absage erhalten hat. Realistischerweise wohl nicht einfach nur wegen meiner Aussage. Aber es lässt mich trotzdem nicht los.
In der Institution, in der ich tätig bin, werden Praktikant*innen sorgfältig ausgewählt (ich erwähne das, weil das nicht überall so ist, dazu später). Ich bin mir sicher, dass die erwähnte Gruppenleiterin hohe Ansprüche hat. Sie nimmt nicht die erst beste, sie will jemanden, der es drauf hat. Der es schon von Beginn weg drauf hat, am besten. Vermutlich ist das irgendwie normal auf dem Arbeitsmarkt. Man hat nicht den Nerv, jemanden übermässig lange einzuarbeiten. Man möchte, dass jemand Selbstbewusstsein verströmt und eine natürliche Autorität mitbringt, damit sich die Person den Kindern gegenüber auch durchsetzen kann. Man möchte jemanden, der am besten im Turnverein, bei der Pfadi und beim blauen Kreuz ist, super fröhlich und schwungvoll daher kommt, jedoch auch knallhart Grenzen setzen kann.
Ich war nicht so, als Praktikantin, damals, mit 20. Nein, ich war definitiv nicht so. Warum ich diese Praktikumsstelle bekommen habe, kann ich mir nachträglich nur mit drei möglichen Szenarien vorstellen, hier sortiert nach der von mir vermuteten Plausibilität:
1) Das Kinderheim, in dem ich mein Vorpraktikum absolvierte, stellte jeden, ich meine wirklich JEDEN als Vorpraktikant*in ein.
2) Ich war die einzige Bewerberin auf diese Stelle, und im Zuge der wachsenden Verzweiflung, diese Stelle besetzen zu müssen, stellte man halt mich ein.
3) Die Verantwortlichen, die mir diese Stelle vergaben, liessen sich durch mein gutes Matur-Zeugnis blenden (und das abgebrochene Studium blendeten sie aus).
Ich will nicht unnötig übertreiben, aber: Ich war zugedröhnt mit Psychopharmaka, als ich mich dort vorstellen ging. Ich hatte gerade ein abgebrochenes Studium, einen Psychiatrie-Aufenthalt und einen Aufenthalt in einer betreuten Wohngruppe für psychisch Kranke hinter mir. Ich kann mich nur bruchstückhaft an mein Vorstellungsgespräch erinnern. Ich hatte keine Erfahrung mit Kindern, gar keine. Ich hatte nie Kinder gehütet, ich hatte keine jüngeren Geschwister, ich war nicht in der Pfadi und trainierte auch keine Junioren (ich hatte ja nicht mal Hobbies). Ich hatte keine guten Argumente, warum ich unbedingt mit Kindern arbeiten wollte, die zu allem Überfluss auch noch behindert waren. Auch zum Thema «Behinderung» hatte ich keine Erfahrung, gar keine. Ich war apathisch, als ich an diesem Tag zum ersten Mal mit einem behinderten Mädchen auf den Spielplatz ging. Ich schluckte Unmengen an sedierenden Medikamenten in dieser Zeit. Ich vegetierte so vor mich hin.
Aber: Ich wurde angestellt, warum auch immer. Mein Vertrag war auf ein halbes Jahr befristet. Spätestens, als ich dort zu arbeiten begann, dürfte dem Team aufgegangen sein, dass sie sich da keine Granate als Praktikantin geangelt hatten. Ich konnte weder Tee kochen, putzen, noch Konflikte mit Kindern austragen. Ich brauchte ewig, um einen Tisch korrekt zu decken, so dass alle Kinder ihre Spezial-Essutensilien und den richtigen Teller vor sich stehen hatten. Ich vergass am laufenden Band, was mir jemand erklärte. Ich war abwesend, ich war extrem müde (Schlafmedikamente my ass), ich war extrem unsicher.
Nach drei Monaten ging es darum, ob mein Vertrag auf ein Jahr verlängert wird. Ich ging zur Chefin und erzählte ihr, was mit mir los war. Ich nannte ihr meine Diagnose, ich erzählte von den Medikamenten und auch vom Psychiatrieaufenthalt. Ich sagte ihr, ich würde sehr gerne bleiben. Sie eröffnete mir etwas später, dass sie sich mit dem Team besprochen hatte und dass sie fänden, sie möchten mir eine Chance geben. «Ich merke, dass du willst. Du willst etwas lernen, und du bist intelligent. Das wird schon.» Mein Vertrag wurde um ein halbes Jahr verlängert. Und schliesslich wurde sogar ein Ausbildungsplatz für mich geschaffen.
Ich hatte einfach nur Glück, ich weiss das. Es hätte alles ganz anders ausgehen können. Spätestens im dritten Ausbildungsjahr, als ich meine Medikamente nicht mehr nahm, psychotisch wurde und nicht mehr arbeiten konnte. Aber es ging gut aus. Und warum?
Weil man mir eine Chance gab.
Man hat mich nicht einfach aussortiert, als klar wurde, dass ich ein Reinfall war. Man hat mir eine Chance gegeben, obwohl ich es definitiv NICHT drauf hatte. Man hat mir eine Chance gegeben, obwohl ich furchtbar langsam war, beim Putzen, beim Tisch decken, beim Interagieren mit den Kindern, beim Lernen von sozialen Skills, beim Umgang mit den Behinderungen, beim Aufbauen meiner Art von Autorität. Ich war langsam, und ich beging Fehler. Ich verschlief häufig, ich schrottete mehrere Haushaltsgeräte, ich reagierte nicht immer richtig auf die Kinder. Trotzdem hat man mir eine Chance gegeben. Und ich vergesse nie, wie stolz meine Chefin auf mich war, als ich 5 Jahre nach Antritt meines Praktikums mein Diplom erhielt (auch meinen Mitstudierenden wurde das bewusst, denn sie pfiff auf zwei Fingern und jubelte lautstark quer durch den Saal, als ich die Bühne betrat, um mein Diplom entgegen zu nehmen). «Ich habe es immer gewusst», sagte sie zufrieden, «ich wusste, dass viel in dir steckt.»
Was, wenn man mir diese Chance verwehrt hätte? Was, wenn ich schon nach einer Viertelstunde Schnuppern auf einer Wohngruppe aussortiert worden wäre, weil «unbeholfen» (und apathisch und depressiv und….)? Ich wäre nicht Sozialpädagogin geworden, so einfach ist das.
Ich weiss, bei meinem jetzigen Arbeitgeber hätte ich mit 20 nie im Leben einen Praktikumsplatz erhalten. Aber: Mein jetziger Arbeitgeber ist der, der mir einen freiwilligen Bonus auszahlte im Dezember, «weil du es verdient hast». Man achtet mich, man schätzt mich. «Ich habe einen guten Instinkt für gute Leute», sagte der Institutionsleiter einmal selbstzufrieden, als es um meine Einstellung ging.
Ich will damit nur sagen: Es kann sich auch für einen Betrieb lohnen, in jemanden zu investieren, der es «noch nicht drauf hat». Vielleicht wird aus diesem Menschen nämlich einmal jemand, den man zu den «guten Leuten» zählt.
. . . . . . .
My schreibt in ihrem Blog zum Thema Psychose/psychische Erkrankung und der Vereinbarkeit von Beruf und Krankheit.