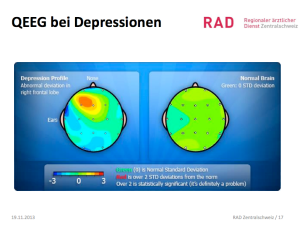In der anstehenden Frühjahrssession wird im Parlament die EL-Reform behandelt werden. Nachdem die Vorlage in die Vernehmlassung geschickt worden war, schrieb ich am 26. April 2014:
Liebe ErgänzungsleistungsbezügerInnen, die in einer WG oder mit dem Konkubinatspartner zusammen wohnen,
Was seitens des BSV in formvollendetem Neusprech unter dem Titel «Höhere anrechenbare Mietzinse in den Ergänzungsleistungen» Mitte Februar in die Vernehmlassung geschickt wurde, klingt zwar sehr grosszügig («Neben der Erhöhung der Mietzinsmaxima sieht der Bundesrat vor, die unterschiedliche Mietzinsbelastung zwischen Grosszentren, Stadt und Land zu berücksichtigen und dem erhöhten Raumbedarf von Familien Rechnung zu tragen») geht aber voll auf eure Kosten.
Die Pro Infirmis «begrüsste» gar die neuen (nach Wohnregion und Familiensituation) «bedarfsangepassten» Mietzinse, obwohl (oder vermutlich eher gerade weil) sie einen massiven Bruch mit dem bisherigen EL-System bedeuten, in dem Eigenverantwortung grossgeschrieben wurde. (…)
Die Idee, dass zukünftig ein allein in der Stadt Zürich wohnender EL-Bezüger («bedarfsangepasst») ein x-faches für die Miete erhalten soll, wie jemand, der in Hindertupfingen in einer 5-er WG wohnt, entspricht zufälligerweise exakt der der Pro Infirmis in jeder Zelle der Institution innewohnende Doktrin (von der leider auch das BSV und andere staatliche Stellen infiziert sind) dass Menschen mit Behinderungen unselbständige Kinder sind, die ihre Situation keinesfalls selbstständig mit ihnen verfügbaren Mitteln verändern können oder verbessern dürfen.
Kürzlich (am 16.1.2018) titelte nun der Tages Anzeiger: Tausende Rentner bekommen weniger Geld fürs Wohnen (nur mit ABO zugänglich):
Rentner, die Ergänzungsleistungen (EL) beziehen, werden bald mehr Geld fürs Wohnen erhalten. (…) Allerdings haben nicht alle EL-Bezüger Grund zur Freude. Wer nämlich in einer Wohngemeinschaft oder mit einem Konkubinatspartner zusammenlebt, wird künftig Ehepaaren gleichgestellt und damit deutlich weniger Wohngeld bekommen als bisher.
Tja, wer hätte das gedacht?!
Weiter im Tagi:
Behindertenorganisationen, die die Erhöhung der Mietzinsbeträge für dringend halten, befürchten insbesondere für Wohngruppen einschneidende Konsequenzen.
Ach, wirklich?
Der Bundesrat begründet die Kürzung der Wohnbeiträge für Mehrpersonenhaushalte mit der Gleichbehandlung mit Ehepaaren. Diese erhielten schon bisher nicht den doppelten Mietbetrag einer Einzelperson, sondern höchstens 1250 Franken pro Monat(…) Zudem hatte die bisherige Regelung den Nachteil, dass Wohngemeinschaften mit drei, vier oder noch mehr EL-Bezügern theoretisch ein grosses Haus mieten konnten, da für jede Person maximal 1100 Franken angerechnet wurden. Eine Vierer-WG könnte so Mietkosten von 4400 Franken tragen. (Tagi)
Oh, sind wir jetzt schon bei der Vierer-WG, damit es noch exorbiatanter klingt? In den Vernehmlassungsunterlagen war noch von einer Luxus-Dreier-WG die Rede:
Heute wird für eine alleinstehende Person in einem Mehrpersonenhaushalt ein Mietzinsanteil bis zum Mietzinsmaximum für Alleinstehende berücksichtigt. Allerdings wird bereits heute in diesen Fällen eine Aufteilung des Mietzinses auf die Anzahl Personen im Haushalt gemacht. Trotzdem wäre es möglich, dass einer EL-beziehenden Person, die mit zwei weiteren Personen zusammen lebt, ein Mietanteil von bis zu 1’100.- im Monat berücksichtigt wird. Die Wohnung könnte in diesem Fall bis zu 3’300 Franken im Monat kosten. Gemäss vorliegendem Vorschlag sollen dieser Person noch höchstens 592 Franken (Grosszentren) für die Miete berücksichtigt werden.
Ich kommentierte dies 2014 folgendermassen:
Damit die Behinderten wissen, wohin sie gehören. Nicht, dass die sich auf Kosten der Allgemeinheit noch ein schönes Leben machen. (…)
Die tendenziöse Formulierung «Jemand mit EL könnte – mit 2 Mitbewohnern – in einer 3300.- Franken Wohnung leben!» ist ausserdem nicht mal mit Zahlen unterlegt, die zeigen würden, wieviele EL-Bezüger das tatsächlich tun. Die Vernehmlassungsunterlagen zeigen hingegen, dass über 70% (!) der EL-Bezüger den maximalen Mietzins gar nicht ausschöpfen, und wenn, dann sind es vor allem Familien und Bewohner von Grossstädten, die dann oftmals sogar noch selbst draufbezahlen, weil das bisherige Mietzinsmaximum nicht reicht.
Tagi, 16.1.2018:
Die Behindertenverbände halten die Gleichbehandlung von Wohngemeinschaften mit Ehepaaren aber für problematisch. Ehepaare teilten meist das Schlafzimmer und benötigten deshalb in der Regel ein Zimmer weniger, sagt Alex Fischer. Es sei kaum vorstellbar, dass zwei IV-Bezüger in Wohngemeinschaften eine Zweizimmerwohnung teilten.
Punkt eins: Herr Fischer von der Procap geht offenbar davon aus, dass IV-Bezüger nur mit IV-Bezügern zusammenleben. So Behinderten-Ghetto-mässig. Punkt zwei: Herr Fischer, wollen Sie etwa andeuten, dass die EL nun auch noch fragen soll/darf/muss, ob die/der WG-PartnerIn auch die/der Bett-PartnerIn ist? Ernsthaft?! Und hätte den schlauen Menschen bei den Behindertenorganisationen nicht schon vor vier Jahren klar sein müssen, dass «bedarfsorientiert» IMMER bedeutet, dass den EL-Bezügern NOCH genauer in die Lebensführung hineingeguckt wird als eh schon? Ach so, dass hat Sie nicht interessiert? Ja, das dachte ich mir.
Ausserdem (Tagi):
Folgen hat die Neuregelung auch für Eltern, die mit einem erwachsenen behinderten Kind zusammenleben. (…) Neu erhält ein solches Rentner-Ehepaar, das auf EL angewiesen ist, zusammen mit der Tochter noch maximal 1800 Franken (Region 1) für die Wohnung. In der Region 2 sind es 1725 und in der Region 3 1610 Franken. Vor allem in grösseren Städten wird die Familie Mühe haben, noch eine genug grosse Wohnung zu mieten.
Ach so ja, die «Behindis» leben allerhöchstens dann mit Nichtbehindis zusammen, wenn es die eigenen Eltern sind. Klar.
Nun denn (Tagi):
Die Behindertenverbände hoffen, dass im Nationalrat die Reduktion der Wohnbeiträge für Mehrpersonenhaushalte nochmals diskutiert wird.
Hoffen kann man natürlich. Viel anderes bleibt einem auch nicht übrig, wenn man die letzten vier Jahre verschlafen hat.
Es ist mir ein Rätsel, wie die Behindertenorganisationen ernsthaft glauben konnten, ihr Ruf nach höheren Mietzinsmaxima für Ehepaare würde für andere Gruppen von EL-BezügerInnen keine negativen Konsequenzen haben. Statt lautstark zu jammern, hätten die Organisationen auch einfach still und leise den Betroffenen raten können, nicht zu heiraten bzw. sich scheiden zu lassen, dann hätte jeder selbst entschieden können, ob das nach dem Abwägen von Vor- und- Nachteilen für die persönliche Situation eine gescheite Option darstellt. Aber wo kämen wir denn hin, wenn Behindertenorganisationen statt öffentlich lautstark über die armen Behinderten zu lamentieren, Menschen mit Behinderung einfach etwas Eigenverantwortung zugestehen würden!?
Die vorgesehenen Bedarfsmieten (nach Wohnregion und Personen im Haushalt) jedenfalls schränken die Möglichkeiten zur Eigenverantwortung für EL-BezügerInnen massiv ein. Und Politiker von rechts bis links finden das richtig gut. Der ungeheuerliche Gedanke, dass sich einzelne Behinderte (oder Menschen im AHV-Alter) – theoretisch – in einer LUXUS-WG einrichten könnten, lässt das ansonsten lautstark vorgetragene Plädoyer für Eigenverantwortung für «Sozialfälle» aller Couleur selbst bei den sogenannt «Liberalen» komplett verstummen.
Auch bei der im Rahmen der EL-Revision zur Diskussion stehenden Vergütung der Krankenkassenprämien griff man bei der NZZ ganz tief in die Neid-Schublade und titelte am 19.1.2018: «Keine Edelkassen für Sozialfälle».
Man denkt kurz: Huch, Blick? Nein tatsächlich, es ist die NZZ. Und der Artikel beginnt so:
Sollen sich Menschen, die ganz oder teilweise vom Sozialstaat abhängig sind, nur noch billigen Junkfood leisten können? Nein. Sollen sie in Bruchbuden leben müssen, in die es reinregnet? Natürlich nicht. Sollen sie bei einer möglichst günstigen Krankenkasse versichert sein? Unbedingt.
(War da nicht mal was mit vom Sozialamt finanzierten Wohnungen in Gammelhäusern…?)
100% der IV-Bezüger mit EL sind krank oder behindert und auch zwei Drittel der Langzeitbezüger in der Sozialhilfe haben gesundheitiliche Probleme. EL-Bezüger im AHV-Alter zählen ebenfalls nicht gerade zur von Krankenkassen am heftigsten umworbenen Zielgruppe. Aber hey, klar, Billigkassen tun’s auch für «die».
Sogar die NZZ bemerkt aber, dass sich dabei ein klitzekleines administratives Problem ergibt:
Würde man alle Bedürftigen immer bei der jeweils günstigsten Kasse versichern, stiegen deren Kosten stark an, sie müsste die Prämien im Folgejahr erhöhen. Die Sozialfälle wären gezwungen, immer wieder zu einer neuen Kasse zu wechseln – ein administrativer Unsinn.
Das Schlimmste an der Bestrafung der «Sozialfälle» (sind ja keine Menschen) ist aber laut NZZ, dass es leider leider für Privilegierte unangenehme Folgen haben könnte:
Leidtragende wären auch alle anderen, vornehmlich jungen und gesunden Versicherten, die Billigkassen bevorzugen.
Kommen wir nun noch zu den – laut NZZ – ganz grossen Abzockern unter den Sozialfällen:
Besonders stossend ist die heutige Praxis bei den Ergänzungsleistungen: EL-Bezüger erhalten die kantonale Durchschnittsprämie ausbezahlt. Ist ihre Kasse günstiger, dürfen sie die Differenz behalten – pro Jahr kann sich das auf Beträge von weit über 1000 Franken summieren.
Dieses «weit über 1000 Franken» hat übrigens eine ganz entzückende Geschichte. Anno 2014 löste die NZZ mit dem Artikel «Prämien-Geschenke vom Staat» haushohe Wellen öffentlicher Empörung aus, in dem sie behauptete, es gäbe EL-Bezüger, die mit der geschickten Wahl des Versicherungssmodells bis zu 5000.- «vorwärts» machen würden. Was aber schlicht nicht stimmte und die NZZ dann (Monate später) korrigierte:
In einer früheren Version dieses Artikels wurde ein Prämienüberschuss von 5000 Franken in einem extremen Einzelfall genannt. Laut der zuständigen Krankenkasse wurde dieser Subventionsüberschuss 2014 tatsächlich an einen EL-Bezüger ausbezahlt. Aufgrund kritischer Reaktionen auf den NZZ-Artikel hat die Kasse den Fall nun noch einmal eingehend überprüft. Diese Überprüfung hat laut der Kasse ergeben, dass der zuständige Kanton ihr eine deutlich zu hohe Durchschnittsprämie gemeldet hatte. Deshalb zahlte die Kasse einen zu hohen Prämienüberschuss an den betroffenen EL-Bezüger aus. Auch ohne diesen Fehler hätte die Person laut Angaben der Kasse immer noch Anrecht auf einen Subventionsüberschuss in vierstelliger Höhe gehabt.
Von 5000.- auf «in vierstelliger Höhe» auf – im aktuellen NZZ-Artikel – angeblich «weit über 1000 Franken». Noch ein Artikel mehr und wir sind dann vermutlich bei «ein paar hundert Franken». Pro Jahr. Aber Hauptsache Empörung. Hauptsache «denen» wirft man das Geld nicht nach. Dass «die» wie oben schon erwähnt, eben auch oft gerade Personen mit eher schlechtem Gesundheitszustand sind und deshalb in der Regel (aber: keine Regel ohne Ausnahme) meist gar nicht die höchste Franchise wählen können (was auch zur Reduktion der Prämien führt) checkt man an der Falkenstrasse mal wieder nicht.
Aber ja, schüren wir doch noch bisschen Neid auf behinderte, kranke und alte Menschen und ihre vermeintliche Luxusversorgung. Man hat ja sonst keine Freuden im Leben.
Sollen staatliche Institutionen möglichst sparsam mit öffentlichen Geldern umgehen? Selbstverständlich.
Sollen bei der Gesetzgebung für den Umgang mit öffentlichen Geldern Bestrafungsfantasien eine entscheidende Rolle spielen? Nein.
Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil Empörung den Blick auf weitergehende Folgen von solchen Beschlüssen oft verstellt. Vor einigen Jahren haben in einer ähnlichen Anwandlung von «Denen zeigen wir’s jetzt aber!» einige Kantone begonnen, Versicherte, die ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlen, auf schwarze Listen zu setzen. Die entsprechenden Personen erhalten nur noch in Notfällen eine medizinische Behandlung. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass das System fehleranfällig ist:
«Wir halten solche Listen für schädlich, unnötig und kontraproduktiv», sagt Sprecher Stefan Heini [Sprecher der Helsana], «da sie einen hohen Verwaltungsaufwand generieren». Zudem komme es zu Fehlern. «Wenn Kantone uns die Angaben betreffend Prämienverbilligungen erst nach Monaten liefern, sind allenfalls Versicherte auf den schwarzen Listen, die nicht drauf wären, würden wir die Angaben früher erhalten.» Dies komme oft vor, sagt Heini. (Quelle: Watson, 15.11.17)
Der Berner Gesundheitsökonom Heinz Locher:
Die Folgen der schwarzen Listen seien gravierend. Verschlechtere sich der Gesundheitszustand einer betroffenen Person, müsse sie später allenfalls notfallmässig behandelt werden. (…) «In vielen Fällen ist dies teurer, als wenn man zu Beginn einer Krankheit eingeschritten wäre», sagt Locher. «Aus meiner Sicht ist dieses System daher unsinnig.» (Quelle: Watson, 15.11.17)
Es ist auch gar nicht so selten, dass Menschen in schweren gesundheitlichen/psychischen Krisen über längere Zeit einfach ihre Post nicht mehr öffnen. Es landen dann also manchmal diejenigen, die medizinische Unterstützung ganz besonders nötig hätten, gerade wegen ihres gesundheitlichen Problems auf der schwarzen Liste. Und kommen davon dann auch nicht mehr so schnell weg.
Das Problem bei Ideen wie der schwarzen Liste oder der billigsten Krankenkasse für «Sozialfälle» ist, dass Nichtbetroffene Lösungen für Situationen vorschlagen, die sie selbst gar nicht kennen (Krankenkassenrechnungen pünktlich bezahlen, wo ist das Problem?). Und auch der persönliche Bekanntenkreis eines NZZ-Journalisten oder des durchschnittlichen Vernehmlassungsantwortenschreibenden setzt sich kaum je aus EL- und Sozialhilfebezügern zusammen. Selbst bei den Behindertenorganisationen, wo man erwarten könnte, dass die Probleme und Bedürfnisse ihrer Zielgruppe einigermassen bekannt wären, hat man bei der Änderung des Mietzins-Systems (wie oben beschrieben) geschlafen. Wenn bei Behindertenorganisationen mehr Betroffene (Auch in ganz kleinen Pensen) angestellt wären, die selber IV und EL beziehen (oder mal bezogen haben) könnte man solche Dinge früher wissen.
Dass hingegen fast 50% der IV-BezügerInnen psychisch krank sind, kann sogar ein NZZ-Journalist wissen. Sich vorzustellen, dass eine Zusatzversicherung (die dann z.B. eben aus dem KK-«Überschuss» bezahlt werden kann), für Menschen, die auf langjährige psychotherapeutische Begleitung angewiesen sind, nicht unbedingt ein Luxus darstellt, ist dann aber offenbar schon zuviel verlangt von so einem NZZ-Journalisten (Therapieplätze bei Psychiatern sind nicht überall leicht zu finden. Die Grundversicherung bezahlt aber nur Psychiater, für Psychologen braucht es eine Zusatzversicherung – ausser bei delegierter Psychotherapie, was aber auch nicht immer möglich ist). Ärzte und Therapeuten sind für chronisch psychisch (und auch körperlich) Kranke oft wichtige Bezugspersonen, die sie über Jahre hinweg begleiten. Die Arzt- und Therapeutenwahl hat für chronisch Kranke also einen etwas anderen Stellenwert als für den NZZ-Journalisten, der sich alle Jubeljahre mal ein Boboli verarzten lässt und salopp befindet:
«Die freie Arztwahl ist ein Luxus, den nicht der Staat finanzieren sollte.»
Ja aber… man kann doch nicht auf die persönlichen Befindlichkeiten eines jeden Sozialfalls Rücksicht nehmen, so geht das doch nicht… Eh, aber auf die persönlichen Befindlichkeiten von Leuten, die nachts nicht schlafen können, wenn sie sich vorstellen, dass möglicherweise irgendwo in der Schweiz ein paar Behinderte in einer Luxus-WG wohnen, darauf muss man Rücksicht nehmen, danach muss man das Gesetz ausrichten?
Das EL-System war mal ganz einfach: EL-BezügerInnen bekamen einen Pauschalbetrag (in dem auch ein Teil für die Krankenkasse einberechnet war) und zusätzlich das Geld für den effektiven Mietzins (bis höchstens 1100.-). Administrativ war das leicht zu handhaben. Mittlerweile überweist die EL wie eine Nanny die kantonale Durchschnittsprämie an die jeweilige Krankenkasse des EL-Bezügers. Kostet die Krankenkasse weniger als die Durchschnittsprämie, erhält der EL-Bezüger den Überschuss zurück (Tipp an die EL-Bezüger: Ihr könnt allfällige Überschüsse direkt Anfang Jahr von der Krankenkasse zurückfordern. Das Geld gehört rechtlich euch. Und nicht den Krankenkassen, die es i.d.R. bis Ende Jahr einbehalten). Das alles verursacht zusätzlichen administrativen Aufwand. Und mit den neu vorgesehenen noch spezifischeren Regelungen wird alles noch aufwändiger. Wenn es mit der demagogischen Neid-Bewirtschaftung und der daraus folgenden Bevormundung so weitergeht, sind wir irgendwann am Punkt, wo man den Leuten sagt, was sie essen dürfen. Und – aufgrund ihres BMI – wieviel. Dafür gibt’s dann entsprechende Essenscoupons.
Das ist dann das komplette Gegenteil dessen, was die Professorin für Volkswirtschaftslehre, Monika Bütler, mal in einem Interview vorschlug:
Es wäre im übrigen sinnvoller, Krankenkassenprämien und Wohnungsmieten in der Sozialhilfe und den Ergänzungsleistungen nicht separat abzurechnen. Die Sozialhilfebezüger sollten den gesamten Betrag erhalten, der ihnen zusteht. Dann können sie selber entscheiden, ob sie mehr für eine Wohnung bezahlen oder ihre Zähne flicken lassen wollen. Das Aufschlüsseln der Leistungen führt eher zu Überkonsum. Gerade der Mietzinswucher in Zürich ist ein gutes Beispiel. Wenn die Sozialhilfeempfänger die Wohnungsmiete von 1100 Franken aus ihren Bezügen selber bezahlen müssten, würden viele ein solches Loch für ihr Geld nicht akzeptieren. Zahlt hingegen der Staat, nimmt man es hin. Gibt man den Leuten das Geld in die Hand, kann jeder damit das Beste für sich machen. Nehmen wir zum Beispiel die Ergänzungsleistungen: Weshalb soll ein alter Mann, der bescheiden in einem ganz kleinen Zimmer wohnt, und dafür jeden Tag sein „Zweierli“ trinken geht, weniger erhalten, als jemand, der Wohn- und Gesundheitskosten ausreizt? Ich finde das nicht besonders liberal.
«Liberal» ist aber leider momentan nicht so in Mode. Neid auf Kranke, Behinderte und Arme dafür um so mehr.
(For the record: das finanzielle Hauptproblem der EL sind nicht die Lebenshaltungskosten; das Hauptproblem sind die Pflegekosten. Aber Neid auf das alte pflegebedürftige Grosi schüren… DAS getraut man sich dann doch nicht. Noch nicht.)